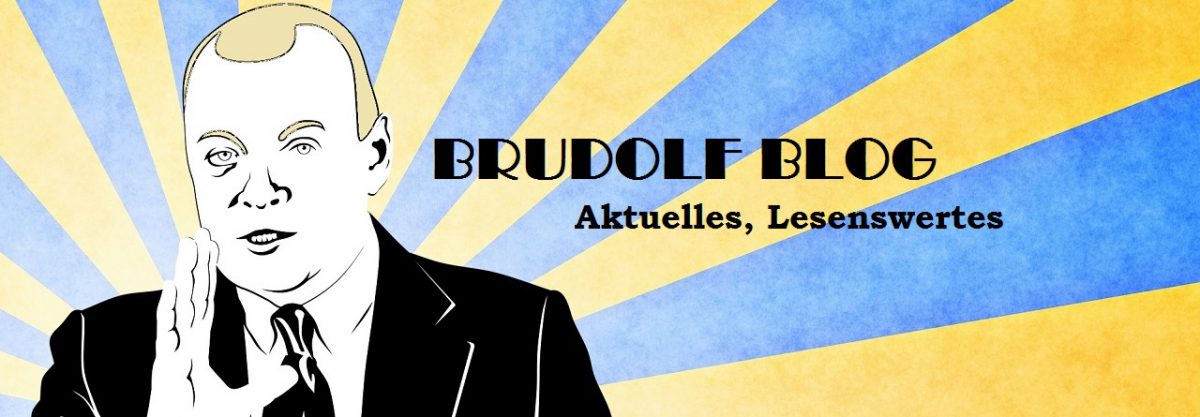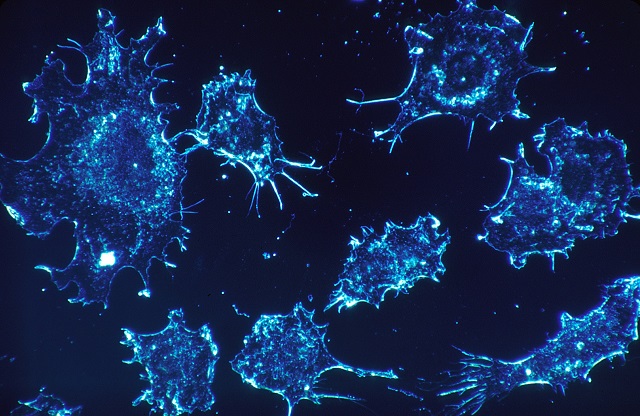Schon einmal über das Leben nach dem Tod nachgedacht? Für die meisten Religionen ist dieser Zustand des Menschen in der einen oder anderen Art und Weise mit Vorstellungen über ein Weiterleben der Seele oder gar einer körperlichen Wiedergeburt besetzt. Und wie die meisten Menschen auf der Welt denken wir über diese Themen erst nach, wenn wir soweit sind oder nahe Personen vom Tod bedroht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt gehen wir nach der Annahme, dass im Endeffekt schon alles gut gehen wird. Dabei sind es sterbende oder kranke Menschen, die uns am meisten über das Leben erzählen können. Es sind oft erst gravierende, lebensbedrohliche Ereignisse, die uns zu einer Atempause in unserem gehetzten Alltag zwingen und uns ermöglichen reflektierend über uns, unser Leben und unsere Mitmenschen nachzudenken. Brudolfblog hat mit drei Menschen gesprochen, die sich bereits weit vor ihrer Zeit mit dem Thema Vergänglichkeit auseinandersetzen mussten. Timur, Kerstin und Christoph erkrankten noch in jungen Jahren an Krebs.
Kerstin, eine adrett wirkende Mathematikerin ist 32. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit. Vor zehn Jahren erkrankte sie an der Diagnose Lymphdrüsenkrebs, einer bösartigen Erkrankung des körpereigenen Immunsystems. Hinter ihr liegt die schwierigste Zeit ihres Leben. Und obwohl sie aggressive Therapien überstanden hat und ihr Krebs heute in Remission (nicht mehr auffindbar) ist, bestimmen die Nebenwirkungen und Spätfolgen der Therapie weiterhin ihren Alltag.
Rückblick. Mit 22 hatte Kerstin ihre Ausbildung absolviert und eine erste Arbeitsstelle bekommen. Zeit für einen lange geplanten Urlaub um das Erreichte zu feiern. Es ist kurz vor Ostern. Die Koffer sind bereits gepackt. Am Tag vor der Abreise bemerkt sie die ersten Symptome. Eine Beule am Hals und blaue Äderchen an der Brust. Kerstin geht zum Arzt. Der findet eine weitere Beule über ihrem Brustbein und eröffnet ihr: „Sie dürfen nicht in den Urlaub. Sie müssen ins Krankenhaus. Sofort.“ Mit ihrer Mutter macht Kerstin sich auf in die Hämatologische Ambulanz des Krankenhauses. Auf dem Weg dorthin gehen Befürchtungen und Vorahnungen durch ihren Kopf. Der Mutter geht es ähnlich. Die Gänge der Ambulanz sind leergefegt. Es ist nach Feierabend. Nur eine einzelne Patientin geht an Kerstin vorbei. Mit Mundschutz, einen Infusionsbeutel vor sich hertragend. Ein surrealer Moment. „Damals kannte ich das noch nicht. Die Frau kam mir wie ein Alien vor.“, sagt Kerstin. Über die Osterfeiertage muss Kerstin schon im Krankenhaus bleiben. Der Pathologe, der einen Knoten untersuchen könnte für die Diagnose, kommt erst nach den Feiertagen wieder. Dann geht alles sehr schnell. Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Kerstin gehen viele Fragen durch den Kopf. Zum Beispiel wie sie der neuen Chefin erklären soll, dass sie mit Krebs im Krankenhaus liegt. Zeit zum Nachdenken bekommt sie nicht. Der erste Zyklus Chemotherapie beginnt direkt nach den Feiertagen. „Der erste Zyklus war der schlimmste.“, erzählt Kerstin. Als ein halbes Jahr später der erste Rückfall erfolgt ist sie schon abgehärtet.
Trotzdem leidet Kerstin unter den Folgen der Therapie. 14 Zyklen Chemotherapie innerhalb drei Reihen, teilweise verteilt über ein halbes Jahr, im dreiwochen-Takt, zwei Reihen Bestrahlungen. Dann folgt die Stammzellentransplantation. „Eine der heftigsten Sachen die ich je erlebt habe“, sagt Kerstin. So stirbt die Hälfte der Patienten laut Kerstin noch im ersten Jahr. Das Immunsystem wird komplett heruntergefahren. Jeder Infekt in dieser Zeit, sei er noch so harmlos, ist dann potentiell tödlich. Kerstins Weisheitszähne werden präventiv gezogen. „Dann ging es los. Wochenlange Durchfälle folgten. Der komplette Körper rebellierte.“, blickt Kerstin zurück.
Doch Kerstin lässt sich nicht unterkriegen. Studiert weiter. Stellt sich für eine Reportage des WDR zur Verfügung. Gehört zu den ersten Mitgliedern der „Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs“, die sich für andere Betroffene einsetzt. Sitzt mit Mundschutz kahlem Kopf im Hörsaal und schreibt ihre Prüfungen. „Ich studierte, als ginge es um mein Leben“, berichtete sie. Und darum ging es damals auch wirklich. „Komischerweise“, so Kerstin, „hat mir das auch Kraft gegeben.“ In ihren ersten akademischen Ferien liegt sie im Krankenhaus. Sie erleidet einen allergischen Schock, bekommt Gürtelrose, die Haare fallen aus. Ihre Freunde und ihre Familie geben ihr in dieser Zeit Halt. An Silvester feiern sie zusammen vor dem Krankenhaus das neue Jahr. Nicht jeder reagiert mit Verständnis. Kerstin wird auf ihren Mundschutz angesprochen und gebeten, doch nach Hause zu gehen wenn sie die Schweinegrippe hat.
Heute ist Kerstin in Remission. Mit den Spätfolgen der Krankheit muss sie ein Leben lang zurechtkommen. Als ihr Krebs diagnostiziert wurde, musste schnell gehandelt werden. An die Konservierung ihrer Eizellen dachte damals niemand. Kerstin fragt auch nicht. Die meisten Patienten und Patientinnen mit Krebs sind schon älter, der Kinderwunsch schon erfüllt oder biologisch ohnehin nicht mehr erfüllbar. Heute ist sie chronisch müde, leidet am sogenannten Fatigue-Syndrom. An manchen Tagen kommt sie morgens nicht mehr aus dem Bett, egal wie lange sie davor geschlafen hat. Ihre Arbeitsfähigkeit leidet darunter. Deswegen macht sie sich sogar Selbstvorwürfe. Und letztlich bleibt die Sorge vor den Spätfolgen. Denn alle medizinischen Standardbehandlungen von Krebs erhöhen wiederum das Risiko weiterer Krebserkrankungen. Sie wünscht sich mehr Sensibilität durch die Menschen der Krankheit gegenüber. „Für mich ist der entscheidende Punkt, dass die Krankheit existentiell ist. Die meisten Menschen glauben, dass die Sache für die Betroffenen nach der Behandlung erledigt ist, dass auch körperlich und seelisch wieder alles wie vorher ist. Aber das ist es nicht. Und dann wundern sie sich, warum man einen Behindertenausweis hat.“
Vor einigen Monaten ist Kerstin umgezogen. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit und hat Salsa tanzen gelernt. Auf die Frage, ob sie der Erkrankung auch irgendetwas Positives abgewinnen kann antwortet sie: „Ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren kann. Ich denke aber es ist eine Selbstwirksamkeitserfahrung, die man da machen kann, wenn man so etwas durchgestanden hat.“
Christoph ist heute 33. Er begann sein Studium – Germanistik und Geografie – nach dem zweiten Bildungsweg. Fragt man ihn nach seinen Vorstellungen über das Lebensende kann er nur müde abwinken. Sein Großvater starb an Krebs, da war er neun Jahre alt. Sein Großcousin verunfallte mit 36 tödlich, ein Freund wählte mit 31 den Freitod, seine Freundin starb mit 24. „Spätestens dann, wenn man alle Tränen geweint hat, fangen die Fragen an“, erzählt Christoph. „Über das Warum und Wozu. Wenn der Tod dann seine Visitenkarte in Form einer Krebsdiagnose in die Hand drückt, denkt man über die eigene Vergänglichkeit nach. Ob man will, oder nicht.“ Christophs Weg in die Krankheit fängt mit Schluckbeschwerden an. Weder der HNO-Arzt, noch der Kardiologe können sich die Beschwerden erklären. Bei einer Magenspiegelung sieht der Arzt eine verdächtige Stelle und entnimmt Proben. Die Untersuchung beim Pathologen bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Bei weiteren Untersuchungen wird festgestellt: Die Speiseröhre, die Umgebung des Magens, die Leber sind betroffen. Die Diagnose trifft ihn wie ein Hammerschlag. Was für Christoph folgt ist Fassungslosigkeit und blankes Entsetzen. Seine Eltern reagieren, wie sein gesamtes Umfeld bestürzt, aber mit großer Solidarität. Wie viel einzelnen Menschen an ihm liegt, spürt er nach dieser Zeit.
Mit der ersten Chemotherapie geht es schnell. Christoph geht vorher zur Cryobank. Denn nach einer Chemotherapie droht den Betroffenen die Unfruchtbarkeit. Danach folgt die Operation. Christoph schreibt sein Testament und informiert seine Eltern wer in seinem Todesfall alles benachrichtigt werden soll. Außerdem entwickelt er eine Art Zweckfatalismus. „Wenn die OP gut geht, habe ich keinen Krebs mehr. Wenn ich sterbe, habe ich keine Probleme mehr.“ In der Operation wird sein Inneres komplett umgebaut. 39 Lymphknoten werden entfernt. Die Speiseröhre wird gekürzt, der Magen hochgezogen. Christoph überlebt und geht erneut durch die Qual der Chemotherapie. Ein Höllenritt beginnt. Seine Haare fallen aus, er bekommt Nasenbluten. Nach der Operation verursacht die Therapie Bauchkrämpfe, Übelkeit. Er muss sich 20 mal am Tag übergeben. Mit einer 10 cm Rest-Speiseröhre jedes mal ein Vorgang unter ungeheuren Schmerzen. Ein Auge wird durch die Therapie dauerhaft geschädigt. Zwischen Operation und Chemotherapie wird eine Rehabilitationsmaßnahme in einer Klinik im Schwarzwald veranlasst. Christoph ist dort der einzige Patient unter 50, was ihm das Ansprechen seiner Sorgen und Nöte nicht erleichtert. Er lernt eine engagierte, junge Psychologin kennen. Ihr autogenes Training hilft ihm den Schmerz auszublenden und rettet ihm in der postoperativen Chemotherapie das Leben. „Hätte ich das nicht gelernt, wäre ich an dieser Stelle endgültig zusammengebrochen.“, berichtet er.
Anschließend beginnt für Christoph die Nachsorgephase. Zwischen fünf und zehn Jahren wird ein Patient in der Regel von den Ärzten begleitet. Danach ist man auf sich alleine gestellt. Für Christophs Krebsart besteht kein Nachsorgeplan. Er muss sich seine Untersuchungen selbst zusammenstellen. Auch heute spürt er noch die Langzeitfolgen der hochagressiven Therapie. An entsprechenden Tagen kämpft er mit Abgeschlagenheit, Übelkeit und Erbrechen, Juckreiz am ganzen Körper und Hitzewallungen.
Seelisch, berichtet Christoph, war das Krankheitserleben für ihn ein Höllenritt. „Man muss sich klar sein, dass es nie mehr so wird wie früher. Was man während der Erkrankung an Angst und Depression aushalten muss, dass lässt sich kaum in Worte fassen. Und auch nach Behandlungsende ist das nicht einfach vorbei. Jedes mal wenn sich der Termin für eine Nachuntersuchung nähert, dann werde ich sehr unruhig. Ab ca. drei Tage vorher kann ich nicht mehr schlafen. Die Angst dass die Krankheit wieder zurückkommt macht einen fertig. Aber wenn der Arzt kommt und sagt – wie bisher -, dass alles in Ordnung ist, dann fällt die Angst zentnerschwer von einem ab.“
Finanziell, so Christoph, war die Zeit für ihn eine Katastrophe. Er hatte über den Zeitraum von einem Jahr kein geregeltes Einkommen. Ohne seine Eltern wäre er damals in die Privatinsolvenz gerutscht. Hartz IV konnte er nicht beantragen, da er sich dafür hätte exmatrikulieren müssen. Doch Christoph brauchte die Hoffnung, nach der Krankheit weiter studieren zu können. Als Konsequenz seiner Krankheit musste er die Prüfungsordnung wechseln. Die neue Prüfungsordnung beinhaltete neue Kurse, die er erst absolvieren musste. Für Christophs Lebensplanung eine entsprechende Hypothek.
Christoph hat begonnen seine Geschichte als Hörbuch aufzunehmen. Für ihn ist das ein Stück Verarbeitung. Eine Möglichkeit, „sich den ganzen Rotz von der Seele zu labern.“ Mitgeben möchte er allen jungen Menschen: „Wenn ihr irgendwelche merkwürdigen Beschwerden habt, dann geht zum Arzt! Vielleicht ist es ja nichts Ernstes, aber vielleicht geht es um euer Leben. Und falls ihr – wegen was auch immer – im Krankenhaus landet: Sagt Bitte und Danke zu den Ärzten und Pflegern. Die kämpfen jeden Tag für euch.“
Timur ist 23, studiert Politikwissenschaft und wirkt ausgelassen und lebensbejahend, auch während er über die schweren Momente der Vergangenheit spricht. Es ist nur schwer vorstellbar, dass er an einer gravierenden Krankheit erkrankt war.
Seine Geschichte beginnt während eines Auslandsjahres in den USA. Unklare Rückenschmerzen die sich mit der Zeit immer mehr verschlimmern zwingen ihn dazu im Stehen zu Arbeiten. Mit der Familie ist er darüber im Austausch. Die ist sich einig, dass er bei einem jungen, kerngesunden Mann wie ihm in erster Linie fehlende sportliche Betätigung sei, die die Schmerzen verursache. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland folgt dem Arztbesuch die schwerwiegende Diagnose: Hodenkrebs. Timur erinnert sich an den Moment der Diagnose: „Der Urologe schaute mich an und schwieg. Sicherlich 15 Sekunden lang, während er auf die Wand starrte. Ja, sprach er, Sie haben einen Tumor. Und ich dachte mir: Tumor? Was meint er damit genau? Er hatte wohl wenig Übung darin so eine Nachricht rüber zubringen. Mein erste Reaktion war dann meine Freundin anzurufen.“ Im ersten Moment ist Timur geschockt. Im zweiten Moment erleichtert. Schlecht ging es ihm ja schon vorher. Die ersten 48 Stunden funktioniert er trotzdem wie ein Roboter. Am gleichen Abend wir die Familie informiert. Am kommenden Tag geht es bereits zum Radiologen bei dem die nächste Hiobsbotschaft folgt: Die Lunge sieht nicht gut aus. Timur hat bereits Lymphknoten- und Lungenmetastasen. „Am schlimmsten war die Zeit direkt nach der Diagnose. Erstmal hört man ja viel und weiß nicht viel über den Begriff Krebs, den man mit Chemotherapie und Tod in Verbindung bringt.“, erzählt Timur. Ein Flyer über Hodentumore bietet ihm erste Informationen an. Mit der Zeit liest er – er nennt das Bewältigungsstrategie – sich immer mehr Literatur zum Thema an. Ist in der Lage gezielte Fragen zu stellen. Er nennt einen Ausspruch des amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt als die Leitidee dahinter: Alles vor was wir Angst haben müssen, ist die Angst an sich. Und so ist es nur die Ungewissheit, die Timur ängstigt. Ein Plan, dass Überwinden der Krankheit, gibt ihm Kraft. Um die Illusion von Kontrolle aufrecht zu erhalten fängt er an seine Arztbriefe zu katalogisieren und digitalisieren. Er organisiert alle Termine selbst und kümmert sich um den reibungslosen Ablauf der Therapien. Was die inhaltlichen Fragen betrifft, folgt er dem Rat der Ärzte. „Die Kampfmetapher der Krebskranken macht hier eigentlich auch keinen Sinn. Denn sie würde bedeuten dass derjenige, der an der Krankheit stirbt eben nicht genug gekämpft habe. Klar ist die Psyche wichtig, aber ohne die ärztliche Expertise wird niemand geheilt. Also kann man hier auch Kompetenzen abgeben.“
„Für meine Familie“, erzählt Timur, „war es wohl allgemein viel schlimmer. So absurd es sich anhört, aber ich hatte eigentlich keine schlechte Zeit. Ich war zuhause, mit meinen Geschwistern, ich wurde bekocht. Zusammen achteten wir darauf dass alle Hygienevorschriften während der Chemotherapie eingehalten wurden.“ Nach drei Zyklen Chemotherapie beginnt Timur schwach zu werden. Doch er achtete darauf jeden Tag draußen spazieren zu gehen. Seine Familie begleitet ihn zu allen Terminen. Seine Zuversicht verliert er nicht. Er erzählt von einer Episode auf der Onkologiestation: „Ich saß mit einem jungen Leukämie-Patienten auf einem Zimmer. Ich dachte mir, wie gut ich doch mit dem Hodentumor noch davon gekommen bin. Später stellte ich fest dass er das gleiche von mir dachte.“ Nach der Behandlung folgt die Rehabilitationsmaßnahme. Davon hat er zuerst keine wirkliche Vorstellung. „Ich dachte dabei an das englische ‚Rehab‘, also eine Einrichtung in der Hollywood-Stars sich von ihrer Alkoholsucht kurieren.“, scherzt er. Sein Onkologe, ein junger Arzt Anfang 30 steht dieser Maßnahme schulterzuckend gegenüber. Timur entscheidet sich selbst dafür. In einer Einrichtung im Allgäu folgt er einem sportlichen Aufbauprogramm. Nach drei Wochen ist er derart gekräftigt, dass er zwei Mittagessen statt einem zu sich nimmt. Zwischenzeitlich isst Timur, der sich vorher fleischlos ernährt hat, sogar wieder Fleisch, um sich körperlich aufzubauen.
Ob sich Timur Sorgen macht, dass die Krankheit zurückkommt? „Ja und nein.“, antwortet er. „Die Krankheit beeinträchtigt mich nicht meinem Alltag, weil es nicht praktikabel für mich ist mit meinen 23 Jahren, der ich noch studiere in drei-monats-Intervallen zu leben. Sicherlich sind die Termine der Nachuntersuchung ein Moment inne zu halten und sich darüber zu freuen, wieder drei Monate geschenkt zu bekommen. Aber sonst ist das für mich kein Thema.“
Timur sieht sich durch die Krankheit enorm gereift. Mehr Gelassenheit, zum Beispiel gegenüber Stress im Studium hat er gelernt, aber auch die Bedeutung davon, Gutes zu tun und zu bewirken. „Ich möchte definitiv die Welt zu einem besseren Ort machen.“, sagt er. Dafür ist er in der Stiftung organisiert und möchte Menschen helfen, die ein ähnliches Schicksal erleiden. Er nennt dies den Egoismus des Altruismus. „Es gibt wenig Dinge, die einem mehr gut tun, als im Kleinen etwas gutes zu tun. Die wenigsten 23-jährigen nehmen sich die Zeit und fragen sich: Warum stehe ich morgens auf? Was treibt mich an zum Leben. Ich habe meine Antwort darauf gefunden. Aber das muss jeder für sich selbst finden. Da gibt es kein Pauschalrezept.“
|
Schon gewusst? |
|
Jährlich erkranken rund 500.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs, davon rund 1800 Kinder im Alter bis 15 Jahre und etwa 15.000 junge Heranwachsende zwischen 18 und 39 Jahren. Die Fallzahlen unter jungen Erwachsenen sind seit einigen Jahren steigend. Rund 224.000 Menschen sterben pro Jahr an Krebs. Damit ist die Krankheit die zweithäufigste Todesursache nach Herz- und Kreislauferkrankungen. Statistische Trends deuten darauf hin, dass Krebs in absehbarer Zeit zur häufigsten Todesursache wird. Neben der immensen, immanenten psychischen Belastung durch die Krankheit können Langzeitfolgen der Krebserkrankung unter anderem die Unfruchtbarkeit der Patienten umfassen, Funktionsstörungen der Organe und Muskelgewebe nach Bestrahlung, Unregelmäßigkeiten des Hormonhaushaltes oder das entstehen einer weiteren Krebserkrankung. Dabei steigert jede Krebserkrankung im allgemeinen das Risiko für neuen Krebs, als auch Chemotherapien und Strahlentherapien Sekundärtumore auslösen können. Dabei ist meist von einer großen Latenzzeit auszugehen. Für junge Patienten spielt dies in sofern eine Rolle als dass ihre Wahrscheinlichkeit, zum Zeitpunkt einer neuen Krebserkrankung noch zu leben höher ist. Für diese Zielgruppe sind Langzeitfolgen kaum untersucht. Neben den gesundheitlichen Folgen der Krankheit – in psychischer und physischer Hinsicht – zerfällt bei Ihnen regelmäßig die Lebensplanung, wenn die Krankheit während einer Ausbildung, des Studiums oder zu Beginn der Karriere eintritt. Die Zeugung von eigenen Kindern kann je nach Behandlung im späteren Verlauf nicht mehr möglich sein. „Die Diagnose kommt zu einer Zeit, in der Gedanken an Sterben und Tod normalerweise keinen Platz haben“, sagt Karolin Behringer, Fachärztin an der Onkologischen Ambulanz des Uniklinikums Köln. In dieser Lebensphase gehe es meist um Unabhängigkeit, sexuelle Orientierung und Erfahrung, die Lösung vom Elternhaus, Ausbildung, Arbeitsplatz, Karriere und die Gründung einer Familie. „Die Erkrankung trifft nicht eine ausgereifte, in sich ruhende Persönlichkeit, sondern eine eher unsichere, unselbstständige und verletzliche, so dass eine doppelte Krisensituation entsteht“, resümiert Volker König, ärztlicher Leiter der Fachklinik für onkologische Rehabilitation Bad Oexen. Eine lebensgefährliche Erkrankung in diesem Alter sei deshalb häufig ein gravierender Einschnitt in die gesamte Lebens- und Zukunftsplanung.“ (ZDF Heute) Es verbleibt: Je früher ein Tumor erkannt wird, desto besser sind die Überlebenschancen. Diese beträgt über alle Alterskohorten und Krebsarten hinweg 50 % für die erste Krebserkrankung. Für junge Heranwachsende wird die Rate bei 80 % angegeben. |
|
Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs |
|
Christoph, Timur und Kerstin sind in der „Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs“ organisiert. Die 2014 gegründete Stiftung ist ausschließlich durch Spenden finanziert. Sie widmet sich der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema, dem Schließen von Versorgungslücken, die vor allem junge Patienten betreffen, dem gezielten Anstoßen gesundheitspolitischer Debatten, sowie der gezielten Förderung von Forschungsarbeit. Sie richtet sich in ihrer Arbeit an Erwachsene zwischen 18 und 39, die von Krebs betroffen sind. Verschiedene Projekte, die zum Teil gemeinsam mit jungen Erwachsenen mit Krebs entwickelt wurden, bieten konkrete Hilfsangebote. Unter http://www.junges-krebsportal.de wurde eine Plattform geschaffen auf der junge Patienten sich mit ihren Fragen, Sorgen und Nöten medizinischer und sozialrechtlicher Art an ehrenamtlich tätige Ärzte und Experten wenden können. Um die Forschungsarbeit zu unterstützen vergibt die Stiftung jährlich ein, mit 10.000 € dotiertes Promotionsstipendium an Akademiker aller Fachrichtungen, die zum Themenkomplex der Stiftung forschen wollen. Informationen: http://www.junge-erwachsene-mit-krebs.de/projekte/promotionsstipendium |
| Beitrag von ZDF Heute |
(rb) (Erstveröffentlichung durch UNICUM Studierendenmagazin, UNICUM Verlag, GmbH & Co. KG, 2016: http://www.unicum.de/de/studentenleben/zuendstoff/diagnose-krebs-erfahrungsberichte)