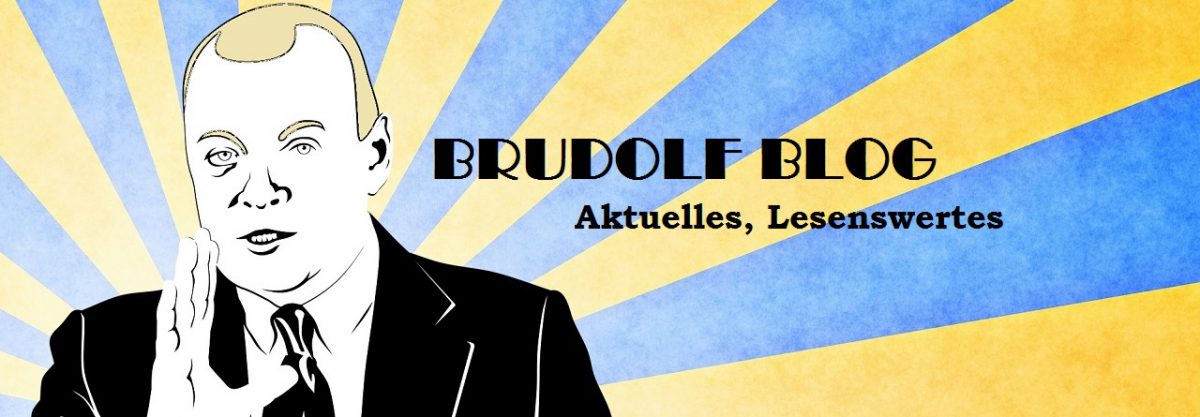„Das gehört sich nicht.“ „Keine bösen Wörter.“ Unsere Methoden der Erziehung stecken voller Mahnungen darüber, was dem Verhaltenskodex als Erwachsener entspricht und was nicht. Wer später dagegen verstößt, wird von der Gesellschaft sanktioniert. Dabei sind Gefühle per se weder schlecht noch gut und ihre Unterdrückung gehört meistens zu den ungünstigen Verarbeitungsformen seelischer Traumatas.
In der bekannten Sternensaga „Krieg der Sterne“ herrscht seit der Premiere am 25. Mai 1977 ein dogmatischer Gegensatz zwischen Gut und Böse. Die Guten sind gut, weil sie sich von ihren Emotionen distanziert haben und sich ein Leben in Harmonie, Gelassenheit und Frieden und voller Wissen verschrieben haben. Die Bösen sind böse, weil sie ein Leben in Emotionen und Leidenschaft führen und sich der Gewissheit des Chaos über die Ordnung gewahr sind. Der Protagonist der ersten drei Filme wird erzogen, sich seinen Gefühlen zu entledigen und los zu lassen, selbst als er eine geliebte Person verliert. Dieses Trauma konnte der Filmheld nie verarbeiten. Die Folge: Was ihm verwehrt wurde bricht sich gewalttätig Bann. Seine Trauer verwandelt sich in Wut und richtet sich gegen die (vermeintlich) Guten. Er transformiert für die kommenden drei Filme zu eine der bösesten Figuren der Filmgeschichte.
EMOTIONEN AS MACHTINSTRUMENT
Das realgeschichtliche Pendant dieser Lehre vom Guten und vom Bösen ist der griechische Mönch Evagrius Ponticus. Er stammte aus der griechischen Schwarzmeerkolonie Pontos und lebte von 345 bis 399. Er gilt als der Gründervater der Achtlasterlehre, aus denen sich die sieben Todsünden der katholischen Kirche entwickelten. Diese lauten: Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit. Sie gelten im katholischen Katechismus als Ursprung aller weiteren Sünden, die sich direkt gegen die 10 Gebote richten. Den Sündern droht der zweite Tod, das ewige Höllenfeuer. Die Errettung ist nur durch die priesterliche Absolution oder tätige Buße und Reue möglich. Das erbrachte den Priestern schon früh einiges an Autorität. Autorität, für die sie sich auch gerne haben bezahlen lassen: 1517, kurz bevor Luther die Reformation einläutet boomt der Ablasshandel; die Sündenvergebung gegen Geld.
Religiöse Dogmen sind regelmäßig Mittel zum Zweck derjenigen, die sich an der Macht erhalten wollen. So bestand die Führungsriege des islamischen Staates fast nur aus Ex-Militärs. Der religiöse Fundamentalismus wurde dem Fußvolk überlassen. Zorn, Neid und Hochmut waren hier gern gesehene Tugenden, solange sie sich nicht gegen die eigene Führung richteten. Gibt es also auch böse Tugenden, die eigentlich gut sind? Die katholische Kirche stellt den Todsünden die Kardinaltugenden gegenüber. Die entstanden im 6. Jahrhundert in Griechenland und lauten: Klugheit, Gerechtigkeit, Frömmigkeit und Tapferkeit. Aus diesen Tugenden wird gleichwohl nie Veränderung entstehen. Zumindest im Mittelalter.Wer Klug ist, erkennt vielleicht die Ungerechtigkeit in der Herrschaft Petri. Wer Tapfer ist, wird den Mut aufbringen dagegen anzukämpfen. Aber wer auch Fromm ist, wird das Wort Petri nie in Frage stellen.
EMOTIONEN ALS INSTRUMENT DER EVOLUTION
Tatsächlich lässt sich jeder Emotion auch eine evolutionäre Funktion zu schreiben. Der Ekel bewahrt uns schon seit Bestehen der Menschheit vor Vergiftungen. Die schmecken oft Bitter. Der Neid hingegen sichert unsere soziale Versorgung in dem er uns dazu antreibt das, was andere haben, auch zu erreichen (oder zu zerstören). In der Psychiatrie gehören Emotionen genauso dazu, wie im nicht-klinischen Alltag. Hier sind sie allenfalls deutlich farbenfroher. Jede Erkrankung kennt ihre Emotionen. Die starke Wut bei Borderlinebetroffenen. Die unbändige Angst bei Psychosepatienten. Menschen mit Depressionen können sich hingegen entrückt von ihren Gefühlen empfinden, wie unter eine Käseglocke.
Emotionen sind ein wesentlicher Modifikator für die Heilung. Schämt sich ein Mensch mit Depressionen für seine Krankheit und zieht sich zurück, wird sich sein soziales Umfeld weiter verkleinern. Das notwendige Empowerment für die Heilung findet dann gar nicht mehr statt.
EMOTIONEN ALS ETWAS UNERWÜNSCHTES
Unsere Gesellschaft bietet dem wenig Raum. In den Stammesgesellschaften nahmen mutmaßlich an Psychosen erkrankte die Rolle der Schamanen ein. Sie durften als Einzige das strenge Ritual kultischer Handlungen durchbrechen. Heute sind starke Emotionen eher verpönt. „Ein Indianer kennt keinen Schmerz.“, ein beliebter Spruch besonders Jungen gegenüber meint im Grunde genommen nur: „Schluck deine Gefühle herunter.“ Den Ursprung dieser Neigung kann man auf die autoritären Phasen der deutschen Geschichte zurückführen. Das gilt insbesondere für die Zeit des Nationalsozialismus in denen Kinder möglichst Bindungsfrei erzogen werden sollten, um der Vereinnahmung durch das Regime nicht entgegenzuwirken.
Wir haben uns wohl alle schon einmal um Entschuldigung gebeten, wenn uns die Tränen gekommen sind oder wir uns im Zorn geäußert haben. Günstiger wäre es sich offen damit zu befassen, woher diese Gefühle kommen. Das es nicht gut ist, diese langfristig zu unterdrücken hat die Wissenschaft bereits nachgewiesen. Unterdrückte Gefühle begünstigen die Entstehung von psychischen Erkrankungen, oder zumindest ungünstigen Strategien in ihrer Bewältigung. Der Alkohol ist dabei ein häufiges Mittel. Allgemein häufen sich dann Bewältigungsstrategien, die entweder für die betroffene Person selbst schädlich sind oder ihnen nahe stehende Personen. Die Klient*In, die ihr Versagen in der Situation spürt, empfindet sich als noch unfähiger, andere Bewältigungsstrategien zu wählen. Deswegen ist die Intervention psychiatrisch geschulter Kräfte so wichtig, wenn die Erkrankung bereits eingetreten ist. Nicht immer sind Helfer*Innen hier aber im Umgang mit den eigenen Gefühlen und denen der Klienten ausreichend gebildet. Denn was für eine in ihren Gefühlen unterregulierte Klient*In gilt, muss für eine überregulierten Klient*n nicht auch gelten. Ihre Bedürfnisse werden in der Psychiatrie vielleicht gar nicht gesehen während die der unterregulierten Klient*In pathologisiert werden.
EMOTIONEN IN DER PSYCHIATRIE
Das psychiatrische Hilfesystem ist Teil unserer Gesellschaft und in besonderer Weise mit den Gefühlen seiner Klient*Innen konfrontiert und der Umgang mit Ihnen stellt eine der großen Herausforderungen für die Zukunft dar. Gefühle können pathologisiert oder als Manifestation der Krankheit wahrgenommen werden. Gefühle können aber auch normalisiert werden und die Klient*In kann einen wirkungsvollen Umgang mit ihren Gefühlen lernen. Unterregulierte Klient*Innen müssen bei der Entwicklung von Strategien unterstützt werden, die ihnen eine bessere Kontrolle ihrer Gefühle ermöglichen. Überregulierte Klient*innen sollten dabei unterstützt werden einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen zu erlangen. Eine gedeihliche Umgebung dazu ist durch ein wertschätzendes, offen und ehrliches Klima in der Einrichtung bestimmt. In der Praxis sollte über Gefühle gesprochen werden und deren Wahrnehmung durch therapeutische Techniken trainiert werden. Durch das eigene Beispiel kann demonstriert werden, wie mit Gefühlen heilsam umgegangen werden kann. Deswegen hat auch der Umgang der Mitarbeiter*Innen miteinander Auswirkung auf die Genesung der Klient*Innen. Psychoedukation und Skillstraining (DBT), wie sie bei VIADUKT e.V. angeboten werden unterstützen den Prozess. Eine besondere Funktion kommt Peer-Berater*innen zu, wie sie beispielsweise in EUTB® beschäftigt werden. Sie können durch professionelle Selbstöffnung das Ansprechen schambesetzte Themen für Ratsuchende deutlich erleichtern. Erst eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen wird sich die Bereitschaft in der betroffenen Person kultivieren, die als unerträglich empfunden Emotionen aktiv zu zu lassen, sich mit ihnen zu befassen und wirksame Strategien zu entwickeln. Manche Betroffene regulieren ihre Emotionen auch fast nur über andere Menschen. Dies wird als ungünstige Emotionsregulation gesehen, wobei sie in Maßen auch sinnvoll sein kann. Zum Beispiel wenn wir jemanden um Unterstützung oder Hilfe bitten. Die externe Emotionsregulation wird aber nie eine Veränderung beim Betroffenen selber erzeugen. Sie schafft nur kurzfristige Entlastung. Als wirkungsvolle Methoden werden antizipierende (präventive) Regulationen und reaktive Regulationen verstanden. Bei vielen psychischen Erkrankungen kommt vor allem der präventiven Regulation eine besondere Bedeutung zu. Das gilt für allem für Klient*innen, die schnell von ihren Gefühlen überflutet werden. Ziel jeder Unterstützung ist die Emotionstoleranz. Erst wenn die Klient*in bei ihren Gefühlen bleiben und sie Ertragen kann, wird sie auch die Angst davor verlieren.
EMOTIONEN IN IHRER VIELFALT
Der Psychotherapeut Andreas Knuf definiert fünf Gefühlsformen. Instrumentelle Gefühle, die in sozialen Beziehungen eine bestimmte Funktion erfüllen (also eigentlich keine authentischen Gefühle sind) – sie werden erlernt. Primäre adaptive Gefühle, die als unmittelbare Folge einer Situation, bzw. einer inneren oder äußeren Wahrnehmung auftreten – sie werden evolutionär erworben und durch bestimmte Situationen ausgelöst. Sekundäre Gefühle, die auftreten wenn schamhaft besetzte primäre Gefühle überdeckt werden sollen – sie werden unbewusst angewendet. Primär maladabptive Gefühle, die zwar direkt durch Situationen ausgelöst werden, aber eigentlich nur Situation passen. Sie sind Zeitreisegefühle, die aus einer früheren Lebensphase wieder hervorgeholt werden und sehr vertraut erscheinen. Begleitet sind sie meist von Ohnmacht und Überwältigtsein. Schließlich Traumaassoziierte Gefühle, die sich als Scham, Angst, Ohnmacht, Hilflosigkeit und Schuld manifestieren können. Sie sind oft die Folge komplexer Traumaerlebnisse, die das Angstsystem übersensibilisiert haben und treten bei den geringsten Triggern auf. Hier ist eine besondere Sensibilität im Umgang mit den Emotionen erforderlich. Traumapatienten brauchen Kontrollerleben, Vorhersehbarkeit und Transparenz.
UMGANG MIT EMOTIONEN AM BEISPIEL ANGST UND ÄRGER
Liegt kein Trauma vor, würde man in der Praxis beispielsweise ein Angstverhalten mit einer Expositionstherapie behandeln. Die Klient*In soll die Erfahrung machen, dass Ängste abklingen. Bei kurzfristigem Bedarf sollten Beruhigungsstrategien angewendet werden, vor allem in der Gesprächsführung, bei Bedarf auch Medikamente wie Benzodiazepime. Ziel in der Konfrontation ist es nicht die Angst verschwinden zu lassen, sie zu unterdrücken, sondern mit ihr zu Leben und die Selbstsicherheit zu gewinnen, sie überwinden zu können. Ärger und Wut, als Triebfeder unserer Selbstverteidigung ist oft die Spitze des Eisbergs unter dessen Wasserlinie sich viele andere Empfindungen verbergen. Wut kann dabei Instrument einer Abwehr sein, die für Fachleute zwar offensichtlich ist, für die Betroffene*n aber nicht. Dann muss die Klient*in bei der Suche nach den Ursachen unterstützt werden. Sie kann aber auch berechtigt sein, aufgrund eines externen Auslösers. Dann muss die Klient*in darin bestärkt werden die Wut auch zu äußern. Ist die Wut komplett unreguliert und nur dann, sollte die betroffene Person darin unterstützt werden die Wut zu regulieren. Der alte Spruch aus der Psychotherapie „Wut tut gut.“ liegt manchmal richtig, manchmal aber auch nicht.
AUSBLICK
Ein neues Konzept in der psychosozialen Arbeit ist seit einigen Jahren das sogenannte Selbstmitgefühl. Lange wurde mit Klient*innen, die ihr Selbstwertgefühl steigern sollten daran gearbeitet die Lebenserfolge zu erfassen und Gefühle von Stolz hervorzurufen. Da Selbstwert aber auch immer mit Vergleichen arbeitet, die den Selbstwert wiederum schädigen können, verschwindet dieses Konzept langsam. Klient*innen sollen sich selbst mit ihren Schwächen, Stärken und leidvollen Erfahrungen gleichermaßen akzeptieren und sich wohlwollend sich selbst gegenüber verhalten. Studien legen nahe, dass dies die Lebenszufriedenheit deutlich erhöht.
(rb)
Quellen: Knuf, Andreas: Umgang mit Gefühlen in der psychiatrischen Arbeit, Psychiatrie Verlag, Reihe Praxis Wissen, 2020. ISBN: 978-3-88414-955-3
Knuf, Andreas: Scham, Minderwertigkeit und Selbsthass überwinden: Was hat Zinédine Zidane mit sozialpsychiatrischen Klienten gemeinsam? In: Kerbe 4/2018.